
Wiederaufbau des Fortunaportals Potsdam
Anmerkungen zur gegenwärtigen Rekonstruktionstendenz
Drei Jahre vor dem „Europäischen
Denkmalschutzjahr“
1975 abgerissen, wäre das Schicksal der in den Grundzügen
noch
gut erhaltenen Ruine des Domkandidatenstifts heute wohl undenkbar.
Wenn es auch durchaus andere Beispiele zu nennen
gäbe, scheint es gelegentlich, als würde jedes noch so
geringe
Bruchstück der Vergangenheit heute an die Oberfläche geholt,
neu geschichtet und konserviert zu werden.
Auch die Absenz solcher Zeugnisse ist dabei
mitunter
von geringer Bedeutung, wenn nur der entstehende Eindruck gefällt.
Ganz im Gegensatz dazu stehen die klassischen
Vorstellungen der Denkmalpflege im Sinne Georg Dehios, der jeden
Gedanken
an Wiederherstellung nicht mehr vorhandener Teile abweist und
allein
die Erhaltung des Bestehenden fordert.
Die Internationale Charta über die Erhaltung
und Restaurierung von Denkmälern und Denkmalgebieten (Venedig
1964)
besagt hierzu in Artikel 15:
„Jede Rekonstruktion ist von vornherein
auszuschließen.
Allein die Anastylose, d.h. der Wiederaufbau vorhandener, aber aus dem
Zusammenhang gelöster Teile, kann in Betracht gezogen werden.
Dabei
müssen die für eine Integrierung erforderlichen Elemente
stets
erkennbar bleiben; sie sind auf das Minimum zu beschränken, das
zur
Konservierung des Bauwerks und für den Zusammenhang seiner Formen
nötig ist.“
In der Praxis finden sich aber, begleitet von
wohl immer bestehender Kritik an „moderner“ Architektur und in der
Hoffnung,
im Kopieren historischer Formen Verbesserung zu erlangen, zahlreiche
Beispiele,
in der eine andere Meinung zum Ausdruck kommt.
So könnte es auch als Form der
Wiedergutmachung
an der Geschichte verstanden werden, wenn in unserer heutigen
Demokratie
vergangene Schlösser und Kirchen wieder neu erstehen, um als
Simulation
gebauter Vergangenheit zwar nicht den Charme und die Patina ihrer
wahren
Vergänglichkeit wiederherzustellen , aber zumindest den Eindruck
historischer
Verbundenheit und Kontinuität zu vermitteln. Ob der Mangel an
Authentizität
dabei verwerflich ist, sei hier dahin gestellt.
Entschuldigend liest sich am im Aufbau
befindlichen
Fortunaportal in Potsdam, dem ersten Grundstein zur Rekonstruktion des
dortigen Stadtschlosses: „Der hilflose Versuch, allein Preußen
für
das Unglück in der Geschichte verantwortlich zu machen sowie
Egoismen
der Gegenwart führten zur unsinnigen Zerstörung von
Glanzpunkten
der Baukunst – und in Konsequenz der ganzen Stadtmitte. Dabei ist die
Rekonstruktion
von Baudenkmälern seit der Antike immer wieder praktiziert worden,
weil die Menschen sich den Verlust an Identität, Geschichte und
Kultur
nicht leisten wollten.“
So wie die Gedächtniskirche Eiermanns dem
Puls der Nachkriegszeit zu entsprechen scheint, ebenso wie die
veränderte
Innenraumgestaltung der Stülerschen Kirchen, wirkt auch der
heutige Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche 56 Jahre nach ihrer
Zerstörung
(als deren Mahnmal die Ruine bis dato galt) als gleichermaßen
selbstverständlich.
Streitbar bleiben Wiederaufbaupläne, wie
im Zentrum Berlins und anderenorts, vermutlich immer.

Wiederaufbau des Fortunaportals Potsdam
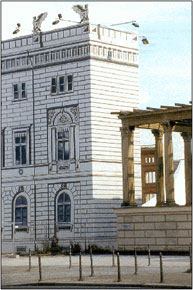
Fassadenattrappe vor dem Wiederaufbau der Kommandantur
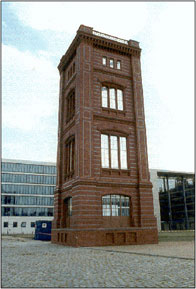
Rekonstruierte Ecke der Bauakademie,
noch ohne Brüstungsfelder