
Friedenskirche in Potsdam
Vorbilder beim Bau des Domkandidatenstifts
Nachdem Friedrich Wilhelm IV. dem Stift die
„Superficies“
über das Grundstück übertragen hat, welches selbst im
Eigentum
des „Kron-Fidei-Komisses“ verbleibt (und in der Erbfolge heute in
Landesbesitz
ist), kann 1858 mit dem Bau begonnen werden. Grundlage sind die
Planungen
Stülers, im Landesarchiv dokumentiert.
Das Bauensemble besteht aus dem eigentlichen
Seminargebäude, H-förmig unterteilt in zwei Riegel entlang
der
Oranienburger Straße und südlich davon, verbunden durch
einen
mittleren Teil mit Bet- und Speisesaal zwischen einem knapp 20m
messenden
quadratischen Atrium sowie einem Hof mit späterem Zugang von der
Monbijoustraße.
Als vierte Atriumwand nach Osten abschließend plant Stüler
eine
ebenfalls quadratische Kapelle, die bei einer Grundfläche von
380qm
mit drei Emporen etwa 725 Personen aufnehmen kann. Hierzu wird es wohl
eher selten gekommen sein. Die hohen Baukosten dieses großen
Kirchenraums
– in „Berlin und seine Bauten“ 1877 mit exakt 142.278 Mark angegeben –
führen so auch dazu, daß zunächst nur die Fundamente
gelegt
werden können (auf denen die Kandidaten in ihren Pausen spazieren
gehen) und sich die Ausführung des Baus erst nach dem Tod von
Stiftsgründer
und erstem Ephorus bis 1874 unter Leitung von Stüve realisieren
läßt.
Auch erst zu diesem Zeitpunkt wird als drittes Element des Entwurfs der
35m hohe Glockenturm fertiggestellt.
In seiner Gesamtkonzeption und bei Ausformung
von Basilika und Campanile geht Stüler auf die Vorstellungen
Friedrich
Wilhelms IV. ein, der durch Beschäftigung mit der Architektur
Italiens,
geprägt von seiner ersten Italienreise 1828 und angeregt vom
1822-28
von Cotta in München herausgegebenen Stichwerk „Denkmale der
christlichen
Religion, aufgenommen von den Architecten J.G. Gutensohn und J.M.
Knapp“,
Formen der Antike und Rennaissance im „Preußischen Arkadien“
umzusetzen
sucht.
Auch in der Rückbesinnung auf
frühchristliche
Motive, die „Urkirche“ und ihre Liturgie sieht der König einen
Ausweg
aus (kirchen-)politischen Problemen.
Wie der Campanile von Santa Maria in Cosmedin
für die Friedenskirche als direktes Vorbild fungiert, finden sich
auch andere Beispiele nach dieser Art. Stüler übernimmt bei
der
Ausführung der Friedenskirche nach dem Tod von Ludwig Persius die
Oberbauleitung.
Auch durch seine gemeinsame Reise mit Friedrich
Wilhelm IV. nach Italien im Winter 1858/59 (ebenso wie mit Eduard
Knoblauch
bereits 1829/30) ist Stüler selbst geprägt von den Bauten des
italienischen Mittelalters und Quattrocento.
Ideen für gußeiserne Säulen (in
der Kapelle des Domkandidatenstifts eingesetzt) oder die im Neuen
Museum
angewandten Techniken dürften dabei eher auf seine vom König
initiierte Studienreise 1842 nach England zurückgehen.
Die klassische Form der altchristlichen Basilika
mit erhöhtem Mittelschiff und niedrigeren Seitenschiffen, der
halbrunden
Apsis im Osten und einem am Narthex im Westen vorgelagerten Atrium ist
damit beim Domkandidatenstift im wesentlichen umgesetzt.
Vorbilder mehr oder weniger frei variierend,
findet sich die Form des abgesetzten Glockenturms bei Stüler auch
an anderen Kirchenbauten in Berlin, so z.B. bei der Jacobikirche in der
Oranienstraße, 1844-45 erbaut. Mit Pfarr- und Schulhaus am Atrium
entlang der Straße gelegen, gibt der Ziegelbau auch einen vagen
Eindruck
vom Erscheinungsbild des Domkandidatenstifts. Nur äußerlich
wiederhergestellt, vermittelt der in den Fünfziger Jahren durch
Paul
und Jürgen Emmerich neugestaltete Innenraum nicht mehr den
„frühchristlichen
Geist“, der der Gestaltung nach Vorbild von S. Quattro Coronati in Rom
ursprünglich zugrunde lag.
Vergleichbar, da nach dem Krieg von den gleichen
Architekten umgestaltet, ist die St. Matthäi-Kirche am
Kulturforum,
die Stüler im gleichen Jahr wie die Jacobikirche in Angriff nimmt.
Direkt durch einen Kirchenbauverein der Nachbarschaft beauftragt,
löst
sich Stüler hier etwas von puristischen Vorbildern, orientiert
sich
in der Dachform eher an Danziger Kirchen und gliedert den Turm, auch
aufgrund
begrenzten Raums, in das Mittelschiff ein.
Weitere Kirchenbauten Stülers sind, neben
der zerstörten und für den Bau der Stalinallee abgetragenen
Markuskirche,
die 1854-58 am Königstor in Nähe des Friedrichshains
erhöht
errichtete Bartholomäuskirche (äußerlich mit nicht mehr
dreigeteiltem Dach erhalten), die Kirche St. Peter und Paul in
Nikolskoe
(bereits 1834-37 mit Albert Dietrich Schadow) oder zahlreiche
Dorfkirchen
wie die am Stölpchensee (1858-59) .
Gerade die neogotisch geprägte Kirche St.
Bartholomäus zeigt, daß Stüler auch als Architekt des
Übergangs
bezeichnet werden kann, zwischen Schinkels Klassizismus und
wilhelminischem
Historismus.
Bei seinen 1844-56 entstandenen
Erweiterungsbauten
für die St. Johannis-Kirche in Moabit (Portikus, Pfarr- und
Schulhaus
mit Arkadenverbindung und freistehendem Glockenturm) als Ergänzung
einer der Vorstadtkirchen Schinkels, zeigt Stüler erneut das vom
König
favorisierte Prinzip und erweist sich als „würdiger Nachfolger“
seines
Lehrers, wobei er das bis heute übliche Etikett des Schülers
selbst von sich wies.
Nicht verwirklicht hingegen werden die Pläne
Stülers für den Neubau des Berliner Doms, neben dem Weiterbau
des Kölner Doms auch eine der „Herzensangelegenheiten“ Friedrich
Wilhelms
IV. Nach ersten klassischen Basilikaentwürfen 1842 steht am Ende
ein
Kuppelentwurf, dessen Finanzierung und Ausführung, so der
Apsisfundamentierung
in der Spree, bereits begonnen ist, bevor Wilhelm I. die Planungen
seines
nun umnachteten Bruders nach ersten Stockungen infolge der Revolution
1848
zehn Jahre später einstellen läßt.
Über die Zusammenarbeit mit dem König
sagt Stüler 1861 in einer Rede auf dem Schinkelfest: „Bei ... den
meisten Bauten begnügte sich der König nicht damit, dem
Künstler
nur Aufgaben zu stellen und die Bearbeitung seinem Talent zu
überlassen,
es drängte ihn zur lebendigsten Teilnahme an der Bearbeitung, wenn
nicht zur Leitung derselben. So liebte er, die Grundidee der
auszuführenden
Bauwerke, mehr oder minder ausgearbeitet, in kleinem Maßstab
selbst
zu skizzieren und die weitere Ausarbeitung dem Architekten
zu übertragen.“
Als weitere Berliner Bauten nichtsakralen
Charakters
in Stülers Werk seien noch folgende erwähnt:
Die üblicherweise als „Stülerbauten“
bezeichneten Gardekasernen des Regiments „Garde du Corps“
gegenüber
Schloß Charlottenburg, im Rahmen seiner Gesamtplanungen für
die Museumsinsel das Neue Museum (auch ein „Stülerbau“) und die
nach
seinem Tod von Johann Heinrich Strack ausgeführte Alte
Nationalgalerie
- in den Worten Friedrich Wilhelms IV. eine „ästhetische Kirche“.
Als Architekt des Königs entwirft
Stüler
auch die Kuppel des Stadtschlosses. Der Zweck des von ihr
bekrönten
Raums ist dabei selbstverständlich religiöser Art.

Friedenskirche in Potsdam

Innenraum

Atrium mit Christusstatue von J.Winkelmann
(Original von B.Thorvaldsen in Kopenhagener
Frauenkirche)

St. Jacobi Oranienstraße
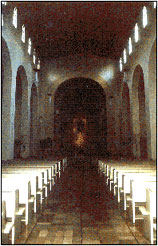
St. Jacobi, umgestalteter Innenraum (Emmerich)

St. Jacobi, Atrium

St. Jacobi, Atrium
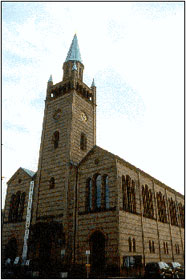
St. Matthäi
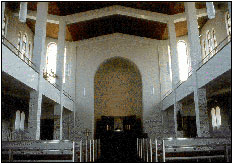
St. Matthäi, umgestalteter Innenraum (Emmerich)

St. Bartholomäus am Königstor
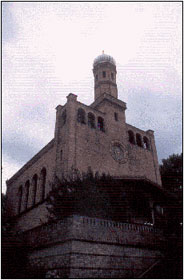
St. Peter und Paul Nikolskoe
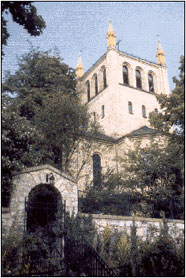
Kirche am Stölpchensee
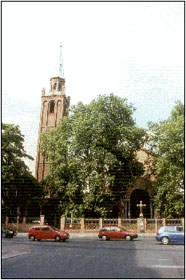
St. Johannis Moabit

St. Johannis, Portikus und Arkaden
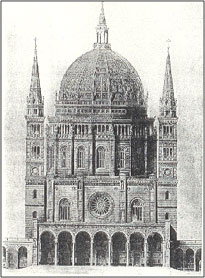
Dom, Kuppelentwurf von 1849

Gebäude der Gardekaserne Charlottenburg

Alte Nationalgalerie
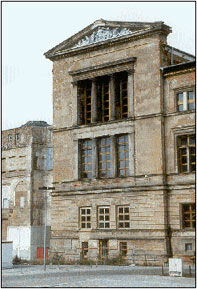
Neues Museum
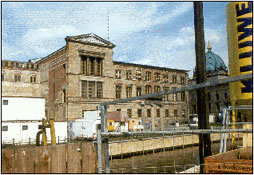
Neues Museum