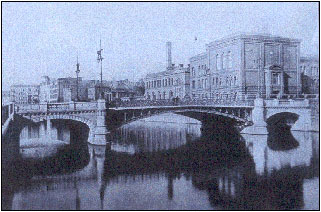
Die Monbijoubrücke vor ihrer Zerstörung
(Wiederaufbau nach Angaben zum Masterplan Museumsinsel vorgesehen)
Städtebauliches Umfeld und religiöse Prägung an der Oranienburger Straße
Für den Standort in der nordwestlichen
Ecke
des Parks Monbijou spricht zur Gründungszeit die Nähe einiger
Einrichtungen: Der (noch Schinkelsche) Dom, wo die Kandidaten sich in
Morgen-
und Abendgottesdiensten in Liturgie üben, die Domschule am
jetzigen
Bahnhof Hackescher Markt, in der sie Religionsunterricht erteilen
sollen,
das Seminar für Stadtschullehrer neben der Synagoge, in dem sie
pädagogisch
unterwiesen werden, oder das Domhospital, in dem Andachten zu halten
sind.
(Später kommen auch Morgenandachten bei Königinwitwe
Elisabeth
im Schloß Charlottenburg hinzu).
Heute ließe sich noch die nahegelegene
Theologische Fakultät der Humboldt- Universität in der
Anna-Luise-Karsch-Str.
hinzurechnen.
Wie schon zu Mitte des 19. Jahrhunderts finden
sich in diesem Bereich der Spandauer Vorstadt aber nicht nur die
genannten
Institutionen christlicher Prägung, sondern gleichermaßen
auch
derer jüdischen Glaubens, die hier mittlerweile wieder das Zentrum
religiösen Lebens bilden. Im Mittelpunkt steht dabei die
Synagoge,
fast zeitgleich mit dem Domkandidatenstift entstanden. Vom Freund F.A.
Stülers, Eduard Knoblauch entworfen, aber wegen dessen Erkrankung
von Stüler ausgeführt und im Innenraum gestaltet. Nach
erfolgter
Teilrekonstruktion befindet sich hier heute das Centrum Judaicum. In
der
Oranienburger Straße 25/26, direkt gegenüber des zur
Disposition
stehenden Grundstücks, ist der Jüdische Kulturverein und das
Anne-Frank-Zentrum zu finden.
Unweit hiervon in der Sophienstraße, durch
den dort gewesenen Sammelplatz zur Deportation besonders mit dem
Schicksal
der jüdischen Bevölkerung verbunden, befindet sich
außerdem
eine jüdische Schule.
Nach Angaben des Pastors der benachbarten Ev.
Sophiengemeinde ist das alltägliche Leben allerdings eher ein
neben-
als ein miteinander, der kulturelle Austausch findet allenfalls auf
kulinarischer
Ebene in den jüdischen Restaurants statt.
Einen möglichen Ort zum Aufbau und zur
Pflege
solcher Beziehungen könnte das Predigerseminar mit einem offenen
Begegnungszentrum
bieten, beispielsweise als Sitz der Arbeitsgemeinschaft „Judentum und
Christentum“.
Baulich ist die Umgebung des Domkandidatenstifts
während der knapp 90 Jahre seines Bestehens einigen
Veränderungen
unterworfen. Zunächst als Abschluß der durchgehenden
Bebauung
entlang der Südseite der Oranienburger Straße konzipiert,
mit
einer zum Park hin frei stehenden Kapelle, entstehen später
östlich
direkt angrenzend weitere Wohnbauten. Westlich wird mit Entstehen des
heutigen
Bodemuseums die Monbijoustraße gelegt, womit aus
ursprünglichen
Brandwänden des Gebäudes nachträglich Giebelfassaden
werden.
Erhaltene Umbaupläne von 1908-1910 lassen dieses nachvollziehen.
Südlich angrenzend entstehen auf
Parkgelände
außerdem 1885 die Anglikanische Kirche St. Georg unter Julius
Carl
Raschdorff (wenig später Architekt des neuen Doms und beim
Innenausbau
des TU-Hauptgebäudes) und 1911 an der Monbijoustraße
ein
königliches Dienstwohnhaus für Gärtner.
Vergleichsweise gewaltig und den Rahmen sprengend
ist das 1900-1913 errichtete ehemalige Haupttelegrafenamt. Allenfalls
die
Bedeutung, die es als Zentrale des dichten Rohrpostnetzes der
Reichshauptstadt
inne hatte, rechtfertigt das Volumen.
Heute steht es bis auf die derzeitige Nutzung
für das Nachtleben größtenteils leer und wartet, wie
der
gesamte „Motz-Block“ (nach den umgrenzenden Straßen Monbijou-,
Oranienburger-,
Tucholsky- und Ziegelstraße benannt), auf eine in Aussicht
gestellte
Millioneninvestition.
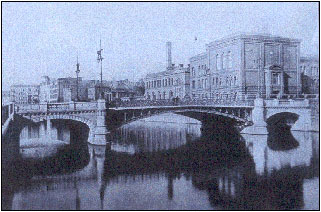
Die Monbijoubrücke vor ihrer Zerstörung
(Wiederaufbau nach Angaben zum Masterplan Museumsinsel
vorgesehen)
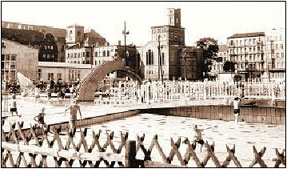
Kinderbad Monbijou kurz nach Eröffnung,
im Hintergrund die Ruine des Domkandidatenstifts
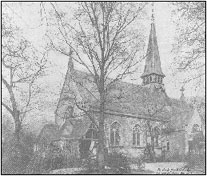
Anglikanische Kirche St. Georg